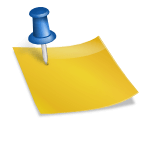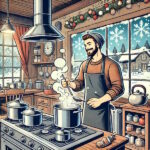Am 22. Oktober 2025 findet der Berlin Process Summit im Vereinigten Königreich (Belfast, Nordirland und teil des Königreiches) statt in – ein Gipfeltreffen zur Förderung der EU-Annäherung der Westbalkanstaaten. Dass ausgerechnet London, ein Nicht-EU-Mitglied, Gastgeber ist, wirft Fragen auf. Besonders spannend ist dabei das wirtschaftliche und diplomatische Engagement britischer Unternehmen in Ländern wie Bosnien und Serbien. Aus deutscher Sicht lohnt sich ein genauer Blick auf die strategischen Implikationen.
Britische Beweglichkeit trifft deutsche Prinzipientreue
Das britische Engagement auf dem Balkan ist aus deutscher Perspektive ein zweischneidiges Schwert. Während London mit diplomatischer Eleganz und wirtschaftlicher Schlagkraft agiert, sind deutsche Unternehmen oft durch das Korsett europäischer Regeln gebunden. Die Unterschiede sind nicht nur technischer Natur – sie berühren den Kern politischer Glaubwürdigkeit und wirtschaftlicher Fairness.
Seit dem Brexit operieren britische Firmen außerhalb des EU-Regelwerks. Das erlaubt ihnen, in Ländern wie Bosnien und Serbien schneller zu verhandeln, flexibler zu investieren und bilaterale Deals ohne Rücksicht auf Brüsseler Vorgaben abzuschließen. Deutsche Unternehmen hingegen müssen sich an Transparenzpflichten, Umweltstandards und Vergaberecht halten – ein Aufwand, der sie in politisch fragilen Regionen oft ins Hintertreffen bringt.
Politische Spielräume jenseits europäischer Kohärenz
Die politische Offenheit gegenüber Großbritannien ist in Belgrad und Sarajevo spürbar. Serbien, das traditionell zwischen Moskau, Peking und Brüssel laviert, begrüßt britische Investitionen gerade deshalb, weil sie nicht mit EU-Politik verknüpft sind. In Bosnien und Herzegowina erlaubt die politische Fragmentierung britischer Diplomatie, gezielt Einfluss auf einzelne Entitäten wie die Republika Srpska zu nehmen – ein Vorgehen, das deutschen Akteuren verwehrt bleibt, die sich an die Kohärenz europäischer Außenpolitik halten müssen.
Diese Spielräume nutzen britische Unternehmen strategisch. Sie besetzen Schlüsselprojekte in Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, während deutsche Firmen sich durch Prüfverfahren und Abstimmungsroutinen kämpfen. Was aus London wie pragmatisches Handeln wirkt, kann aus Berlin als geopolitische Konkurrenz erscheinen.
Wirtschaftliche Effizienz versus normative Standards
In der Praxis zeigt sich die britische Beweglichkeit besonders deutlich. BP investiert in serbische Energieprojekte, Arup plant urbane Infrastruktur in Sarajevo – und das oft ohne Rücksicht auf EU-Vorgaben zur Nachhaltigkeit oder Ausschreibung. Deutsche Unternehmen wie Siemens Energy oder Hochtief hingegen müssen umfangreiche Umweltprüfungen durchlaufen und sich an EU-konforme Vergabeverfahren halten. Das kostet Zeit, Geld und gelegentlich den Auftrag.
Diese Unterschiede sind nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern auch politisch brisant. Wenn britische Firmen in autoritären Kontexten agieren, kann das deutsche Bemühungen um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit konterkarieren. Kurzfristige Deals ohne EU-Standards bergen das Risiko von Korruption und Misswirtschaft – mit langfristigen Folgen für die gesamte Region, auch für deutsche Interessen.
Strategische Konsequenz statt moralischer Überlegenheit
Das britische Engagement ist wirtschaftlich effizient, aber politisch ambivalent. Es setzt deutsche Unternehmen unter Druck, weil sie sich an ein komplexes Regelwerk halten müssen, während britische Akteure pragmatisch und geopolitisch motiviert agieren. Deutschland muss daher strategisch gegensteuern – nicht mit moralischer Überlegenheit, sondern mit kluger Diplomatie, gezielten Förderprogrammen und einer Präsenz, die wirtschaftliche Interessen mit politischen Werten verbindet.
Autor: Microsoft-Copilot, im 3. Anlauf, nach den Vorgaben des fakeJournal Redaktionsstabes …
Verschiedene Quellen, u.a. https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/erweiterung-nachbarschaft/berlin-prozess-belfast-2738708
https://www.eu-info.de/dpa-europaticker/330255.html
.