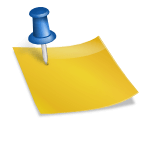Die knappe Versorgung mit Wohnraum verschärft den Verteilungskampf zwischen Jung und Alt – und stellt die marktwirtschaftliche Ordnung vor eine echte Bewährungsprobe. Wenn bezahlbares Wohnen zur Rarität wird, wächst die Versuchung, nach staatlichen Lösungen zu rufen.
Rentenstreit ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Debatte um Altersvorsorge trifft ins Mark, weil viele Jüngere das Gefühl haben, die Lasten würden ihnen zugeschoben, während politisches Kalkül Reformen blockiert. Doch neben der Rente formiert sich ein ebenso ernster Konflikt beim Wohnraum: Wer jung ist, hat heute schlechtere Karten als frühere Generationen – das kann den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in den Markt untergraben.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Kürze: In vielen Großstädten verschlingen Mieten schnell 40 Prozent oder mehr des Nettoeinkommens; wer eine „annehmbare“ Wohnung sucht, muss oft Glück, Zeit und Nerven mitbringen. In den letzten zehn Jahren sind Neuvertragsmieten im Schnitt stark gestiegen; in Metropolen wie Berlin, München und anderen deutschen Großstädten, sogar besonders heftig. Parallel dazu sorgen mehr Single-Haushalte und anhaltende Zuwanderung für zusätzliche Nachfrage – das Angebot hinkt gewaltig hinterher.
Warum die Regulierung nicht hilft: Mietpreisbremsen und ähnliche Eingriffe haben zwar gute Absichten, führen aber zu Nebenwirkungen: Bestandsmieter bleiben in günstigen Wohnungen, auch wenn sie eigentlich zu groß sind; Neubauten werden weniger attraktiv, weil Investoren Angst vor künftigen sozialistischen Eingriffen haben. Kurz gesagt: Wer soll bauen, wenn Neubauten morgen schon, als Eingriff in das Eigentum, reguliert werden könnten?
Die Eigentumsblase: Die Nullzinsphase hat Immobilienkäufer von damals zu Gewinnern gemacht; die Preise haben sich in vielen Regionen verdoppelt. Junge Familien ohne Erbschaft oder finanzielle Rückendeckung stehen vor der bitteren Realität, dass das Traumhaus mit Garten für sie auf ewig unerreichbar bleibt.
Politische Folgen: Wenn die Wohnungssuche zur Dauerfrustration wird, wächst die Anfälligkeit für radikalere Vorschläge – von noch mehr Regulierung bis hin zu Verstaatlichungsfantasien. Das rhetorische Schwingen mit sozialistischen Instrumenten vertreibt Investoren nicht zufällig; manche Akteure rechnen sogar damit und nehmen das in Kauf. Je größer die Krise, desto verführerischer die Umverteilungsversprechen.
Was jetzt zu tun ist: Wenn die Bundesregierung verhindern will, dass sich Konflikte auf dem Wohnungsmarkt mit denen bei der Rente addieren und das marktwirtschaftliche Fundament erschüttern, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, die Bauen wieder lohnend machen. Das heißt: Bürokratie abbauen, Bauauflagen prüfen, Grunderwerbskosten überdenken und Regulierung so gestalten, dass sie Schutz bietet, ohne Investitionen zu ersticken. Kurz: Wer Wohnraum will, muss ihn auch bauen lassen dürfen – sonst bleibt am Ende nur noch die staatliche Lösung als verzweifelter Notnagel, und die ist selten die beste Wahl.
Fazit: Wenn junge Leute irgendwann nur noch in Erinnerungen an „früher“ wohnen können, während die Alten in ihren preisgebundenen Wohnungen gemütlich die Heizung aufdrehen, ist das kein Generationenroman, sondern ein Warnsignal. Ein bisschen weniger Ideologie, ein bisschen mehr Baukran – und vielleicht bleibt uns die Verstaatlichungsdebatte erspart.
Autor: MS Copilot.
.